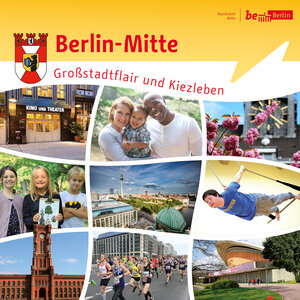Wegen Corona-Vorsorge ist am Montag, den 23. März 2020 das “Haus am Lietzensee” geschlossen, wo sich die Esperanto-Gruppe an jedem Montag um 14 Uhr im Kaminzimmer trifft. Stattdessen gibt es aus Anlass des Weltwassertags (jeweils am 22. März) einen Rundgang um den Lietzensee mit Informationen zum Wasser in Berlin und der Welt.

Foto: de.wikipedia.org/wiki/Lietzensee
Die Frühlingstage will die Esperanto-Gruppe zu einem Spaziergang im Park um den Lietzensee nutzen. Der Treffpunkt ist am Montag, 23. März 2020 um 14 Uhr die Grosse Kaskade an der Dernburgstrasse am oberen Becken neben der Informationstafel.
Roland Schnell, Dozent für Nachhaltigkeit und Experte für Wassermanagement und Abfallwirtschaft an der SRH-Hochschule (Charlottenburg, Ernst-Reuter-Platz) wird über die geologische und ökologische Situation des Lietzensees und anderer Berliner Gewässer informieren.
Wassertag 2020 im Zeichen von Klimaveränderung
Seit 1993 rufen die Vereinten Nationen in jedem Jahr dazu auf, sich am 22. März mit Fragen des Wassers zu beschäftigen. Der Aufruf für das Jahr 2020 lautet: »Wir haben nicht die Zeit zum Warten. Jeder kann etwas tun!« und weist auf die vielfältigen Zusammenhänge zwischen Klimawandel und Wasser hin. Eine effizientere Gestaltung der Wasserverorgung reduziert den Ausstoss von Klimagasen und die Anpassung des gesamten Wassersektors an den Klimawandel schützt die Gesundheit und rettet Leben.
Beim Gang um den Lietzensee, eines der zahlreichen offenen Gewässer in Berlin das Schutz bedarf, werden auch Berliner Probleme angesprochen. So steht die Esperanto-Gruppe Lietzensee unter dem Motto “Esperanto als Therapie” und kümmert sich in einen ganzheitlichen Konzept um körperliche und geistige Fitness im Alter. Dazu gehört auch das reichliche Trinken von Wasser, wobei man in Berlin problemlos das Wasser aus der Leitung trinken kann. In anderen Ländern ist sauberes Trinkwasser oft nur in Plastikflaschen zu bekommen ist, die dann ihrerseits ein Umweltproblem darstellen und als Mikroplastik im Wasser wieder zurückkommen.
Esperanto-Brunnen im Kongo
 Spenden von Esperanto-Freunden aus aller Welt haben den Bau einer Wasserversorgung in der Kleinstadt Kalima mit 20.000 Einwohnern in Ostkongo ermöglicht. Die öffentliche Zapfstelle, die mit Quellwasser durch eine 1 km lange Leitung versorgt wird, erhielt den Namen »Ans« nach einer niederländischen Esperantistin die sich mit ihrem Mann Hans Bakker viele Jahrzehnte für Afrika engagiert hat. 2020 sind weitere Spenden für eine Erweiterung zusammengekommen. Bericht auf Esperanto beim Chinesischen Rundfunk (CRI online) von 2015.
Spenden von Esperanto-Freunden aus aller Welt haben den Bau einer Wasserversorgung in der Kleinstadt Kalima mit 20.000 Einwohnern in Ostkongo ermöglicht. Die öffentliche Zapfstelle, die mit Quellwasser durch eine 1 km lange Leitung versorgt wird, erhielt den Namen »Ans« nach einer niederländischen Esperantistin die sich mit ihrem Mann Hans Bakker viele Jahrzehnte für Afrika engagiert hat. 2020 sind weitere Spenden für eine Erweiterung zusammengekommen. Bericht auf Esperanto beim Chinesischen Rundfunk (CRI online) von 2015.
Der Weg am Ostufer des Lietzensees entlang führt zum Parkwächterhaus, in dem es einst eine Verkaufstelle für Mineralwasser und Milch gegeben hat, das aber wegen Renovierung noch geschlossen ist. Von der Liegewiese am Nordufer erreicht man die U-Bahn (U2) am Sophie-Charlotte-Platz.
über den Lietzensee
Der Lietzensee gehört zu den Grunewalder Seen, die während der letzten Eiszeit entstanden. Der dichten Wald, der ihn einst umgeben haben soll, wurde 1824 von dem preußischen Staats- und Kriegsminister Job von Witzleben zum Park umgestaltet.
Der des Sees leitet sich vom Dorf Lietzow bzw. Lützow, das zum Benediktinerinnenkloster St. Marien gehörte und für die Nonnen wurde er als Fischteich genutzt. Begriffe wie Lietzow, Lützow, Lusce, u. ä. werden aus dem slawischen Wort luccina hergeleitet, was so viel heißt wie ‚Sumpf‘ oder ‚Lache‘ heisst.
 Nach dem Tod Witzlebens 1837 wechselte der See mehrfach den Besitzer. Der Kunstgärtner Ferdinand Deppe machte ihn 1840 mit einer Rosen– und Georginenzucht zu Sehenswürdigkeit. Von 1905 an wurden vornehme Mietshäuser direkt am Ostufer gebaut, wobei drei Grünflächen ausgespart blieben: der Witzlebenplatz, der Kuno-Fischer-Platz und der Dernburgplatz. Ein Beschluss des Charlottenburger Stadtrats im Jahr 1910 verhinderte die totale Bebauung des West- und Nordufers, was bis heute so geblieben ist.
Nach dem Tod Witzlebens 1837 wechselte der See mehrfach den Besitzer. Der Kunstgärtner Ferdinand Deppe machte ihn 1840 mit einer Rosen– und Georginenzucht zu Sehenswürdigkeit. Von 1905 an wurden vornehme Mietshäuser direkt am Ostufer gebaut, wobei drei Grünflächen ausgespart blieben: der Witzlebenplatz, der Kuno-Fischer-Platz und der Dernburgplatz. Ein Beschluss des Charlottenburger Stadtrats im Jahr 1910 verhinderte die totale Bebauung des West- und Nordufers, was bis heute so geblieben ist.
Der 1904 aufgeschüttete Damm für die Neue Kantstraße teilt den See in zwei Teile. Pläne für eine Umgestaltung des Sees stammten aus dem Jahr 1912, als Erwin Barth Barth zum Gartendirektor von Charlottenburg ernannt worden war. Als Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen wurden von 1918 bis 1920 neue Grünflächen im Jugendstil angelegt. Die Große Kaskade, 1912/1913 von Erwin Barth und Heinrich Seeling angelegt am Südende des Sees, und das Parkwächterhaus von 1924/1925 sind geschützte Baudenkmale.
Die 100 Jahre seines Bestehens sollen am 13. und 14. Juni 2020 gefeiert werden. Die Vereine „Bürger für den Lietzensee e.V.” und „Parkhaus Lietzensee e.V.“ bereiten ein Fest für Alt und Jung, mit Unterstützung vieler Menschen aus unserer Nachbarschaft vor.
Parkwächterhaus
Das Parkwächterhaus wurde 1925 angrenzend an die „Volks- und Spielwiese“ nach Plänen des Charlottenburger Magistratsbaurats Rudolf Walter von der Mauerei & Zimmerei August Spahr errichtet. Es liegt an der Wundstraße 39, (ehemals Königsweg) und hatte im Erdgeschoss öffentliche Toiletten für Damen und Herren, einem Raum für die Parkverwaltung und eine Verkaufsstelle für Milch und Mineralwasser Im Obergeschoss war eine Dienstwohnung für den Parkwächter. Das Parkwächterhaus ist bis 2021 wegen Renvierung geschlossen. Aus Mitteln des Bundes (245.000 €) und der Lottostiftung (600.000 €). Der Verein hat 30.000 € Spenden gesammelt. (Meldung in der Berliner Morgenpost vom 21.11.2019 mit Foto). Dazu hatte er 2016 ein mobiles Eiskaffe eingerichtet, nachdem der Biergarten 2012 geschlossen worden war.
Große Kaskade
Die Große Kaskade befindet sich am südlichen Ende des Parks an der Dernburgstraße. Es gibt noch eine Kleine Kaskade mit Rundbecken und Fontäne im nördlichen Teil an der Wundtstraße. Die beiden Kaskaden wurden 1912-13 von Erwin Barth und Heinrich Seeling angelegt.
Eine Gedenktafel informiert, dass die Stadt Charlottenburg 1910 den See mit dem noch unbebauten Westufer gekauft hatte. Zur Verbesserung der Wasserqualität sollte Frischwasser zugeführt werden und dazu eine repräsentative Kaskade angelegt wer
Sie wurde 2006 mit Mitteln der Stiftung Denkmalschutz Berlin saniert Das Bezirksamt hat parallel die wassertechnischen Anlagen (246.000 €) instand setzen lassen, so dass das Wasser aus dem Lietzensee kostensparend und ökologisch sinnvoll zur Kaskadenbewässerung verwendet werden kann.Die angrenzenden Grünflächen gartendenkmalpflegerisch überarbeitet und in Anlehnung an den Entwurf des Gartenarchitekten Erwin Barth wieder hergestellt. Die Hohlwege wurden von neuem angelegt, die Rasentreppen – in Anpassung an die Wasserstufen – und die Treppenanlagen neu modelliert sowie die Wegebeläge teilweise saniert.
Mehr information




 Spenden von Esperanto-Freunden aus aller Welt haben den Bau einer Wasserversorgung in der Kleinstadt Kalima mit 20.000 Einwohnern in Ostkongo ermöglicht. Die öffentliche Zapfstelle, die mit Quellwasser durch eine 1 km lange Leitung versorgt wird, erhielt den Namen »Ans« nach einer niederländischen Esperantistin die sich mit ihrem Mann Hans Bakker viele Jahrzehnte für Afrika engagiert hat. 2020 sind weitere Spenden für eine Erweiterung zusammengekommen.
Spenden von Esperanto-Freunden aus aller Welt haben den Bau einer Wasserversorgung in der Kleinstadt Kalima mit 20.000 Einwohnern in Ostkongo ermöglicht. Die öffentliche Zapfstelle, die mit Quellwasser durch eine 1 km lange Leitung versorgt wird, erhielt den Namen »Ans« nach einer niederländischen Esperantistin die sich mit ihrem Mann Hans Bakker viele Jahrzehnte für Afrika engagiert hat. 2020 sind weitere Spenden für eine Erweiterung zusammengekommen.  Nach dem Tod Witzlebens 1837 wechselte der See mehrfach den Besitzer. Der
Nach dem Tod Witzlebens 1837 wechselte der See mehrfach den Besitzer. Der 







 Im Text wird auch erwähnt, dass sich auf der Laufbahn Worte in Esperanto befinden und angemerkt, dass sich Metzger für diese internationale Sprache eingesetzt habe.
Im Text wird auch erwähnt, dass sich auf der Laufbahn Worte in Esperanto befinden und angemerkt, dass sich Metzger für diese internationale Sprache eingesetzt habe.