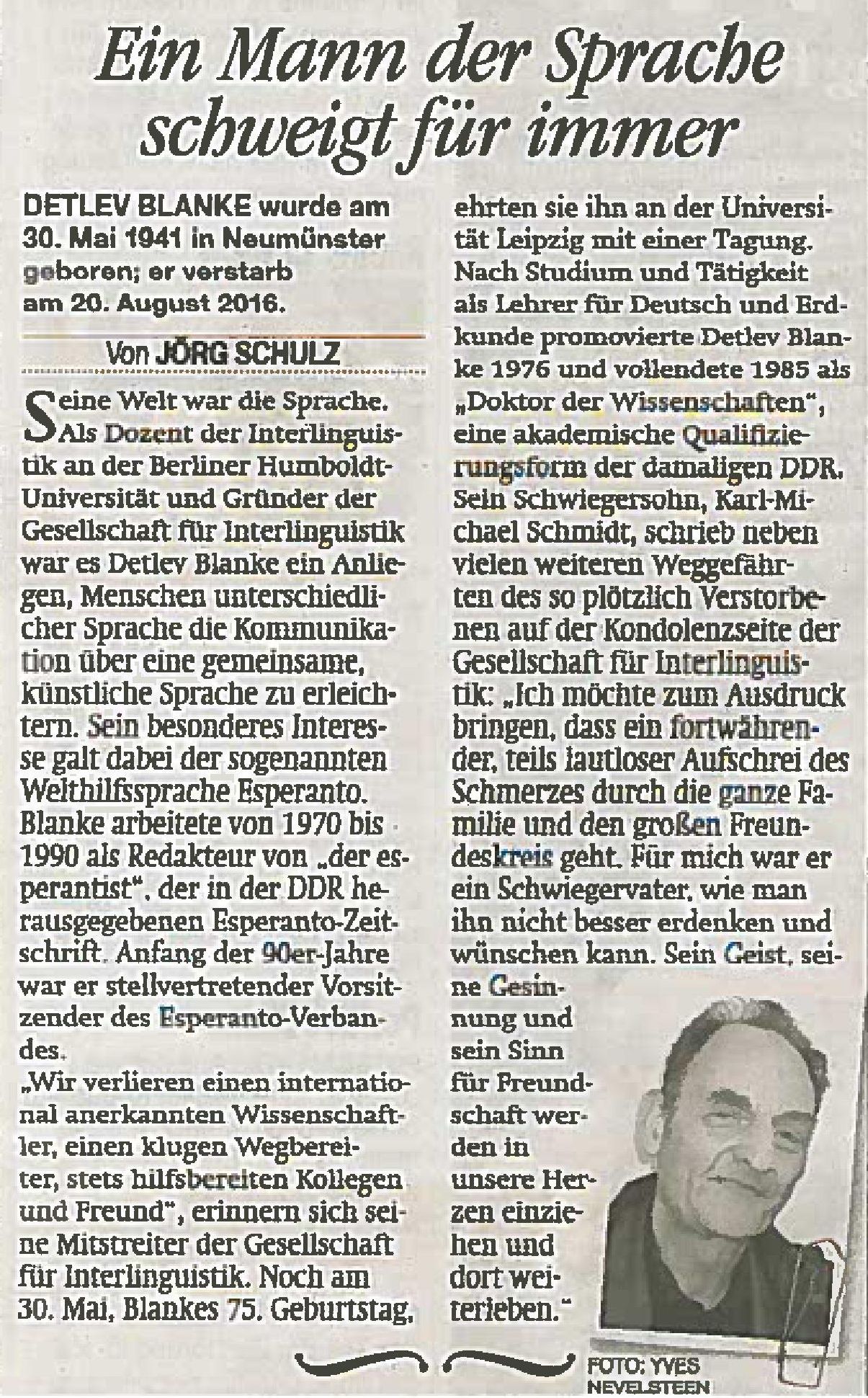An der Schwelle zum Jahr 2017, das dem Gedenken an den 100. Todestag von Ludwig Zamenhof gewidmet sein soll, ist es Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, wo man verlässliche Informationen über den werten Verblichenen bekommen kann.
- Details zum Lebenslauf (Übersicht in Ondo de Esperanto 2009)
- Eine Webseite aus Tschechien bei Esperanto.cz (Ausgesprochen umfassend, mit Tondokumenten, Videos, Gedichten über Z., Übersetzungen auch als Download, Biografien, Bildmaterial, Familie und und und)
- Fotos aus dem Leben, von der Familie, von der Beerdigung 1917, z.B. Galerio de Zamenhofoj
- Veröffentlichungen, vorwiegend eigene Schriften (Dazu gibt es einen Eintrag in der Esperanto-Wikipedia)
- Bonusmaterial, etwa Hinweise auf Denkmäler, Strassen, Plätze und Parks weltweit
Anregungen könnte die virtuelle Ausstellung der Bayerischen Staatsbibliothek geben, auch ein wenig den zeitgenössischen Kontext berücksichtigt. Zamenhof hat sein Produkt nicht im luftleeren Raum geschaffen, sondern konnte an bestimmte Entwicklungen (z.B. Volapük) anknüpfen, wenn auch nicht immer bewusst.
Biografisches Material
Im Katalog von UEA (libroservo) werden es dutzende biografische Werke aufgelistet, in verschiedenen Nationalsprachen und teilweise vergriffen. Leider nur in wenigen Fällen mit Rezensionen oder Kommentaren (und die sind selten hilfreich).
Die klassische Biografie ist sicher die Schrift von Edmond Privat aus dem Jahr 1920, die auf Esperanto unter dem Titel “Vivo de Zamenhof” erschienen ist und bei Wikisource eingesehen werden kann. Andere Version mit weiteren biografischen Arbeiten. Es gab zahlreiche Auflagen und Übersetzungen in andere Sprachen, darunter soll es auch eine deutsche Version geben. Weidmann (CH) plant angeblich eine Übersetzung in Deutsch und Französisch für 2017)
Noch zu Lebzeiten von Zamenhof wurden Einzelheiten aus dem Leben von Zamenhof in Zeitschriften veröffentlicht. So gibt es einen Brief von ihm in russischer Sprache an N. Borovko, in dem er selbst die Entstehung von Esperanto schildert ( auf Esperanto, englische Übersetzung) und kurz nach seinem Tod gab es natürlich eine stattliche Reihe von Nachrufen auf Esperanto und aus den verschiedensten Ländern. Auch die nationalsprachige Presse hat ihn gewürdigt. Selbst Berliner Tageszeitungen war es trotz des Krieges eine Erwähnung wert.
Im “Memorlibro pri la Zamenhof-Jaro” (PDF), das 1960 zum 100-jährigen Geburtstag, erschien, finden sich biografische Beiträge. Darunter der Text “Rememoroj pri la lastaj jaroj de mia patro” des Sohnes Adam Zamenhof, sowie Beiträge von Prof. G. Waringhien und Edmond Privat. Die darin formulierte Sicht hat lange Zeit das Bild von Zamenhof geprägt. Etwa die Darstellung von Ivo Lapenna
Ebenfalls dieser Epoche zuzurechnen ist die Biografie von Marjorie Boulton: “Zamenhof, creator of Esperanto”, London 1960 (englisch) und als “Zamenhof, aŭtoro de Esperanto” 1962 auf Esperanto.
In einer Rezension zum Buch “Historio de Esperanto” von Aleksander Korjenkov sind die folgenden älteren Biografien aufgeführt:
- Holzhaus, A. 1969. Doktoro kaj lingvo Esperanto. Helsinki. (pp. 19-34)
- Cherpillod A. L.L.Zamenhof: Datoj, faktoj, lokoj. — Courgenard, 1997.
- Drezen E. Analiza historio de Esperanto-movado. — Leipzig, 1931.
- [Itô Kanzi] Ludovikito. Plena Verkaro de Zamenhof. — Tokyo, 1973-1997.
- Zamenhof. Movado. Doktrino: Studoj / Komp. W. Żelazny . — Warszawa, 1983. (Konzept)
Walter Żelazny beurteilt einige biografische Werke, leider ohne genaue bibliographische Angaben.
Libro de M. Ziolkowska estas simpla fabelo, posedas valoron nur el la vidpunkto de la porinfana literaturo. Libro de E. Privat estas tre bona didaktike kun multaj misfaktoj. Eseo de R. Krasko estas bona, sed ankau bazighas sur kelkaj premisoj de Ziolkowska, kvankam aliloke opinias tezojn de shi kiel malghustaj. Libro de M. Boulton estas tre bona vivskizo pri Zamenhof kun didaktikaj ecoj. Shajnas, ke malgrau “agho” kaj senbezonaj komparoj kun situacio en Sovetio la plej elstara studo pri Zamenhof restas plu tiu de Drezen. Elstaras kelkaj eseoj de Waringhien, tiuj posedas plej grandan valoron de la scienca analizo.
Bei dem Werk ist zu beachten, dass es 1983 in der Blützezeit des Kommunismus entstanden ist und sich an entsprechende Vorgaben bei der Bewertung orientieren musste.
Von Walter Żelazny gibt es auf Esperanto ein Buch von 2014 mit dem Titel “Ludoviko Lazaro Zamenhof, Lia pensaro, sekvoj kaj konsideroj” laut Beschreibung “Esperanta versio, parte adaptita por la Esperanta publiko, de analiza rigardo al la vivo, verkaro kaj idearo de Zamenhof” als übersetzung einer polnischen Veröffentlichung.
Neuere biografische Ausarbeitungen sind
Das neuere Material ist nur ansatzweise online zugänglich (etwa Auszüge in Google-Books). Einge Orginaltexte von Zamenhof, die von anderen zitiert werden, kann man bei Wikisource oder im Projekt Gutenberg (unter Z) insehen. Die Briefe und Reden bei Kongressen tragen zum Verständnis der Lebensgeschichte von Zamenhof bei und die Orginaltexte erlauben es die Beurteilung der Biografen zu überprüfen.
Das Material scheint auf eine Vielzahl von elektronischen Ressourcen verteilt vorzuliegen, die teilweise nicht mehr zugänglich sind.
Was von Esperantisten nicht erfasst wurde, hat möglicherweise archive.org (53 Treffer Ende 2016)
Es gibt unzählige Kurzbiografien (auch in Websites), die in der Regel lediglich das ausführlichere biografische Material zusammenfassen. Darunter
Heiligenlegenden
Viele Biografien halten es für angemessen, aus Zamenhof einen Titanen des Geistes zu machen: der tiefsinnige Denker, der geniale Sprachwissenschaftler, der bescheidene Mediziner, der aufopferungsvoll und ohne dafür Lohn zu nehmen seine armen Patienten behandelt.
Beispielsweise liest man im Klappentext zu dem Buch Die Zamenhofstrasse
Der Augenarzt Dr. Ludwig L. Zamenhof (1859 – 1917) war ein echter Philanthrop und ein begeisterter Verteidiger der Menschenrechte. Aufgrund seiner eigenen leidvollen Erfahrungen wandte er sich entschieden gegen jede Form von Nationalismus und Chauvinismus, gegen Diskriminierung nationaler, rassischer und religiöser Minderheiten. Zamenhofs Ziel war nicht esoterische oder sektiererische Sprachbastelei, sondern er schuf unter schwierigsten Bedingungen die Grundlage zur Verwirklichung seiner zutiefst humanistischen Ideen eine wirklich einfache und neutrale Universalsprache, die der Verständigung aller Menschen dient.
Zamenhof hat sich nie so gesehen und den Kult, der um ihn gemacht wurde, immer abgeleht. Aber er konnte sich nicht einmal mit der bescheidenen Bitte durchsetzen, ihn nicht mehr als “Majstro” anzusprechen.
Er wollte die Entwicklung der Sprache Fachleuten überlassen (Akademio) und konnte nicht verhindern, dass seine Meinung zu einzelnen Fragen wie die Worte eines Propheten rezipiert werden.
Vor allem die langanhaltende Auseinandersetzung mit IDO führte dazu, dass der Grundbestand (Fundamento) für sakrosankt erklärt wurde und Änderungen (selbst wenn sie sachlich Sinn gemacht hätten) als Gefahr betrachtet wurden. Dabei hatte Zamenhof von Anfang an Änderungen, die sich aus der Praxis ergeben, vorgesehen.
Es bildete sich in den ersten Jahren eine verschworene Gemeinschaft derer heraus, die eine “reine Lehre” vertaten und immer von Spaltern und Abweichlern bedroht waren.
Auch in organisatorischen Fragen war Zamenhof relativ unbeleckt, ja geradezu naiv. Er glaubte fest an das Gute in den Menschen und konnte nicht damit umgehen, dass auch in der jungen Esperanto-Bewegung um Macht und Einfluss gerungen wurde. Beiweitem nicht alle handelten aus den selben edelmütigen Motiven, die man Zamenhof zugestehen kann. Allerdings ist das noch nie systematisch aufgearbeitet worden, da man der Lichtgestalt des Begründers auch eine vollkommen makellose Weltorganisation (UEA) zur Seite stellen wollte. Die Fehler und Konflikte innerhalb von UEA lassen sich allenfalls zwischen den Zeilen erahnen, die Konflikte mit der Arbeiter-Esperanto-Bewegung sind schon klarer konturiert. Aber ein klares Bekenntnis zu Fehlern und Irrtümern sucht man auf allen Seiten vergebens.
Allerdings fällt der wesentliche Teil in die Zeit nach Zamenhof und man kann ihm allenfalls vorwerfen, dass er oft zu weich und nachgiebig war. Aber das war eben seine Persönlichkeit. Er war eben nicht dazu berufen eine Weltorganisation zu führen und das wollte er auch überhaupt nicht.
Heute erscheint das Ringen um Macht in der Esperanto-Bewegung wie der Wiederschein einer fremden Welt. Aber es scheint wirklich so zu sein, dass in den ersten zwei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts Esperanto eine reale Chance hatte zur “neutralen Welthilfssprache” zu werden, weil man keinem der Konkurrenten (Französisch, Englisch, Deutsch, eventuell Russisch oder Spanisch) die Vorherrschaft einräumen wollte, aber mehrere Sprachen für ineffizient ansah. Von Simultanbersetzung konnte man ja nur träumen und viele heute selbstverständliche technische Hilfsmittel lagen noch in weiter Ferne.

 300 Efeupflanzen setzten Aktive von A-Z Hilfen, Auxilium Klientenverwaltung, Stadtagenten und Esperanto-Liga Berlin am 1. November 2016 auf der nordöstlichen Grünfläche des Esperantoplatzes in Berlin-Neukölln. Auch die Landschaftsarchitektin Frau Longardt arbeitete mit. Nach ihrem Plan wird der Platz verschönert und nachhaltig bepflanzt. Die Auxilium-Klientenverwaltung versorgte die Aktiven mit Kaffee, Tee und Keksen. Eine Kollegin des Interkulturellen Theaterzentrums bewässerte die Neuanpflanzung.
300 Efeupflanzen setzten Aktive von A-Z Hilfen, Auxilium Klientenverwaltung, Stadtagenten und Esperanto-Liga Berlin am 1. November 2016 auf der nordöstlichen Grünfläche des Esperantoplatzes in Berlin-Neukölln. Auch die Landschaftsarchitektin Frau Longardt arbeitete mit. Nach ihrem Plan wird der Platz verschönert und nachhaltig bepflanzt. Die Auxilium-Klientenverwaltung versorgte die Aktiven mit Kaffee, Tee und Keksen. Eine Kollegin des Interkulturellen Theaterzentrums bewässerte die Neuanpflanzung. Besonderer Dank gilt den Stadtagenten, die die 300 Efeupflanzen zur Verfügung stellten.
Besonderer Dank gilt den Stadtagenten, die die 300 Efeupflanzen zur Verfügung stellten.